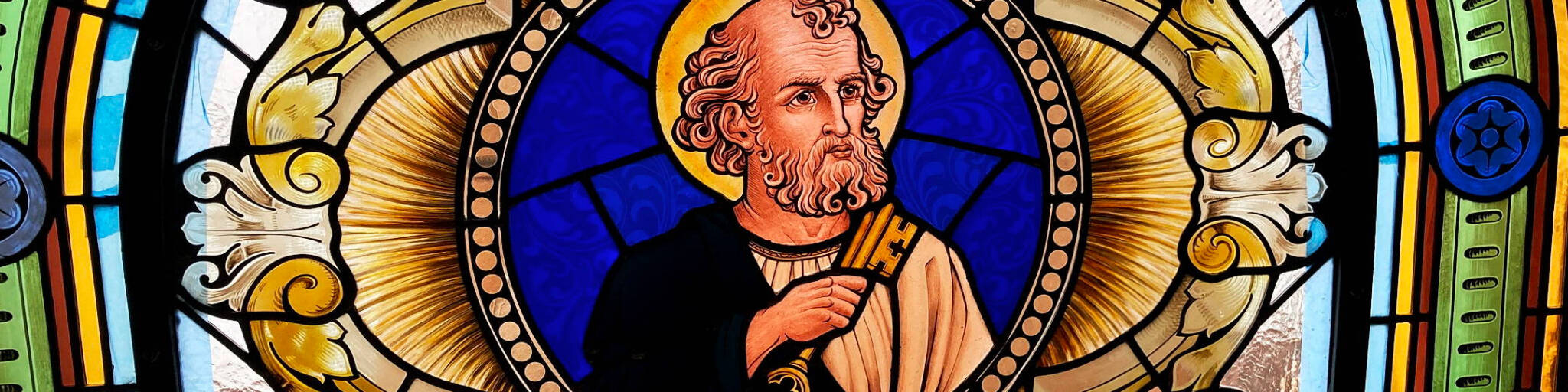Kirche neu denken
25. Apr 2015
Kreissynode Halberstadt tagte
Präses Hans-Jörg Bauer war sichtlich zufrieden: "Wir haben heute Samen gesät, und im Herbst werden wir die ersten Pflanzen sehen." Gemeint war das Thema "kirchliches Bauen", in das der Vorsitzende des synodalen Bauausschusses - Pfarrer Ernst Ulrich Wachter - zuvor in einem leidenschaftlichen Vortrag eingeführt hatte. Kirchliches Bauen der Zukunft müsse sich in erster Linie nach den Bedarfen der Gemeinden orientieren (der ganze Vortrag unten). In kleinen Gruppen wurde das Thema dann konkret und auch kontrovers diskutiert. Die synodalen Ausschüsse werden nun zusammen mit dem Kreiskirchenrat die Gemeinden und Regionen des Kirchenkreises beraten und im Herbst ein erstes Gebäudekonzept zur Diskussion stellen.
Weitere Schwerpunkte waren: 1. die Gründung eines Zweckverbandes zum gemeinsamen Betrieb der Kreiskirchenämter Halberstadt und Egeln. Dazu waren Präses Erik Hannen, Superintendent Matthias Prozelle sowie Amtsleiterin Susanne Trittel angereist und verfolgten gespannt die Debatte, in deren Anschluss die Synodalen mit überwältigender Mehrheit für die Errichtung des Zweckverbandes stimmten; 2. der Bericht der Visitationskommission unter Leitung von Propst Christoph Hackbeil. Mit dem Schwerpunkt "Regionen" waren im Vorfeld viele Gespräche mit Gemeindekirchenräten, dem Diakonischen Werk sowie Regionalbeiräten, aber auch kommunalen Vertretern geführt worden. Der ausführliche Bericht soll dem Kreiskirchenrat im Mai vorgelegt werden.
Superintendentin Angelika Zädow dankte den Mitgliedern des Bauausschusses, die sich in Zusammenarbeit mit dem Baureferat und dem Kreiskirchenamt mit allen Gebäuden des Kirchenkreises vertraut gemacht hatten und die Gruppenleitung auf der Synode übernahmen.
Präses Hans-Jörg Bauer bedankte sich mit einem großen Blumenstrauß bei Amtsleiterin Erika von Knorre für das präsentierte "Zahlenfeuerwerk" zur Jahresrechnung.
Vortrag von Pfarrer Ernst-Ulrich Wachter, Vorsitzender des synodalen Bauausschusses
Wir halten es nicht auf…
Das, liebe Synodalen, ist das Grundgefühl vieler Gemeinden und zwar nicht erst seit heute, nicht erst seit der Wende, nicht nur im Osten. Keine der vielen Strukturreformen der Vergangenheit, keine Vergrößerung von Pfarrbereichen, keine Kirchspielbildung hat das ändern können. Wir halten es nicht auf. Warum ist das so?
Die Gottesdienste werden seltener, die Besucherzahlen davon aber nicht höher, im Gegenteil. Die Zuständigkeit eines Pfarrers erstreckt sich auf zum Teil unzählige Orte, Gebäude, Befindlichkeiten und Traditionen. Unmöglich, alles in guter Qualität zu bewältigen.
Nehmen Sie meine Pfarrstelle. Bis 1996 war der Pfarrer von Elbingerode für Elbingerode zuständig. Heute, 19 Jahre später, ist er es für Elbingerode, Benneckenstein, Königshütte, Sorge und Elend.
Nicht mehr für eine Kirche, sondern für fünf. Nicht mehr für ein Pfarrhaus, sondern für drei und zwei Gemeindehäuser. Das Geld reicht nicht für alles, die Zeit auch nicht, die Konzentration der Gedanken und die Motivation schon gar nicht.
Es wird immer schwieriger, Pfarrstellen zu besetzen. Längst sind die Gemeinden in der Landeskirche in einem Wettbewerb um die hauptamtlichen Mitarbeiter.
Wir halten es nicht auf. Das ist das Grundgefühl. Viele Gemeindeälteste fühlen sich wie Sterbebegleiter ihrer Kirche und Gemeinde.
Da gab es nach der Wende die große Hoffnung, die Menschen würden zur Kirche zurückkehren, weil es ja wieder erlaubt war. Die Volkskirche war das Modell. So wollten wir es gern wieder haben. Aber das war ein Trugschluss. Manche haben diese Hoffnung niemals geteilt, andere haben es bald eingesehen, einige aber wollen es bis heute nicht akzeptieren. Längst sind wir eine Minderheit.
Wir nehmen es wahr. Aber akzeptieren wir das? Die Landeskirche gibt sich staatstragend. Nüchtern betrachtet aber fühlt man sich bisweilen, wenn man dem ganzen Treiben von außen mit etwas Abstand zusieht, wie in einem Panoptikum der Illusionen.
Wir erhalten Gebäude, wir erhalten Programme, wir erhalten Traditionen aufrecht, die für eine Mitgliedschaft von 100% erdacht waren, mit einer Mitgliedschaft von 20% der älteren Generation. Gleichzeitig steigen mit Recht die Qualitätsansprüche.
Längst vergessen die Zeit, die Ehm Welk in den „Heiden von Kummerow“ beschreibt, als der Pastor Breithaupt in Stiefeln vom Pflügen seines Ackers kommt, sich den Talar überwirft und auf dem Friedhof ein Mitglied der Dorfgemeinschaft unter die Erde bringt.
Der Eindruck ist verbreitet, die Kirche hätte die gute Zeit hinter sich. Gemeint ist mit der guten Zeit dann die Zeit, als Geld keine Rolle spielte, jedes Dorf seinen Pfarrer hatte, sich Kirchlichkeit von selbst verstand.
Nun, ich sage es ihnen offen, ich konnte dieser Interpretation unserer Vergangenheit in den 30 Jahren, die ich jetzt Christ bin und zur Kirche gehe, nie etwas abgewinnen - einer Vergangenheit der Schlüsselbünde werfenden Pfarrer im Konfirmandenunterricht, einer Vergangenheit der großen Staatsnähe, die die Mehrzahl der Gemeinden und Pfarrer in der Nazizeit den Deutschen Christen zutrieb, einer Vergangenheit, als die Kirche sich Konsistorien, Pfarrvillen und prunkvolle Superintendenten-Residenzen baute, aber in den Arbeitervierteln und Vorstädten mit Abwesenheit glänzte.
Ich will mal fragen: Welcher Vergangenheit trauern wir da eigentlich hinterher?
Wir halten es nicht auf! Warum eigentlich nicht?
Ich will Ihnen meine Vermutung dazu sagen. Es liegt daran, weil wir der Entwicklung immer hinterherlaufen. Es ist als liefen wir auf einer Bahn im Stadion und versuchten den vor uns Laufenden zu fassen zu kriegen.
Wir sind mit einem Bein immer in der Vergangenheit. Nicht in der Vergangenheit des Neuen Testaments, die durch den Auferstandenen die Gegenwart und die Zukunft der Kirche ist, sondern in der Vergangenheit, die wir die goldene nennen.
Wir hinken hinterher. Und wir haben so große Angst, den Anschluss zu verlieren, dass wir es nicht einmal wagen, über die Sinnhaftigkeit dieses Wettlaufs nachzudenken. So erhalten wir Gebäude, die eigentlich fürs Leben kaum mehr einer braucht. Wir erhalten Veranstaltungen aufrecht mit zwei Leuten, weil wir an diesen Stellen wenigstens den Eindruck haben, es gäbe uns noch.
Wie halten wir den nur auf, der da vor uns herläuft im Stadion?
Wir wollen ja nichts Böses, im Gegenteil.
Wir wissen es aus unserem eigenen Leben, wie gut es tut, zu glauben, mit einer Gottesbeziehung durchs Leben zu gehen. Wir wissen es, wie schön und hilfreich es ist, wenn man beten kann, wenn die Woche und das Jahr und das Leben einen Rhythmus haben.
Wir wissen es von uns, wie befreiend die Botschaft von Karfreitag und Ostern, von Vergebung und Hoffnung auf Ewigkeit ist. Aber wir kriegen es nicht gesagt, weil wir hinterherlaufen. Aber wir kriegen ihn nicht zu fassen.
Im Stadion ist es einfach.
Anhalten. Sich besinnen. Umkehren und dem anderen mit offenen Armen entgegenlaufen. - Ja, im Stadion?!
Aber ich liebe den Vergleich. Denn die Menschen sind ja nicht wirklich weg. Sie wohnen ja bei uns, in unseren Städten und Dörfern, in unseren Nachbarschaften, auch wenn sie nicht oder nicht mehr zur Kirche gehören, nicht glauben. Selbst in den kleinsten Dörfern unseres Kirchenkreises würden die Kirchen nicht ausreichen, die Menschen zu fassen.
Die Menschen sind nicht weg, sie sind ja da. Aber wir sind mit uns und unserer Trauer beschäftigt, wir denken, wir müssten Traditionen und Gewohnheiten aufrechterhalten, weil sonst alles den Bach runtergeht. Und dabei wissen wir, dass dieser Weg seit Jahrzehnten nicht funktioniert. Wir wissen es!
Nehmen Sie Halberstadt. So viele Menschen wohnen hier, die nichts wissen von Gott, von Christus, vom Geist Gottes, der tröstet und ermahnt. Sie sind da!
Das halten Sie für utopisch und total unrealistisch? (P)
Ich will ihnen sagen, was utopisch und unrealistisch ist.
Wenn Jesus sich vor 12 Männer und ein paar Frauen hinstellt, von denen die meisten Analphabeten sind, die keine Kirche, kein Geld, keine Kirchenleitung haben und er zu ihnen sagt: Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern.
Das ist unrealistisch.
Aber es geschieht bis heute. In Myanmar gibt es mittlerweile mehr Christen als in Deutschland. Man schätzt die Zahl der Christen in China auf ca. 120 Millionen mit steigender Tendenz. Die Kirchen des Südens haben keine Pfründe, aber sie haben eine Botschaft, und die muss unter die Leute. Und die haben wir auch. Dieselbe.
Und die Frage, die sich stellt, ist die, wie gelangt die zu den Menschen in Halberstadt und Rodersdorf, in Sorge und Dittfurt?
Was hat das alles mit dem Thema Bau zu tun? Sehen sie, unser Bauausschuss hat auf diese Bausynode gedrungen, weil wir eines immer deutlicher beobachten: Wir halten es nicht auf, wir schaffen es nicht.
Das, was es bräuchte, wären einladende Gebäude, in denen Gemeindearbeit stattfindet. Was es bräuchte, wäre gedanklicher und zeitlicher Freiraum bei Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen, um sich mit offenen Armen auf die Stadionbahn zu stellen.
Wir hätten so viele Ideen, wie Gemeindearbeit schön werden könnte, wie Glaube beginnt zu leben, ganz neu. Aber wir sind beschäftigt mit Anträgen und Mieterbeschwerden, mit leeren Kassen und oft auch leeren Herzen.
In Gemeindekirchenratssitzungen wird unendlich Zeit mit Baufragen und Mieterfragen verbracht, nicht selten für Häuser und Kirchen, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir geben Gelder aus für Häuser, die Fässern ohne Böden gleichen.
Wann haben Sie zuletzt im Gemeindekirchenrat mit vergleichbarem Aufwand ein Kinderfest vorbereitet, einen Gottesdienst geplant, eine Gruppe gegründet, sich ausgetauscht über ihren Glauben und ihre Visionen für die Gemeindearbeit?
Miefig sind nicht selten unsere Kirchen in den Dörfern, aber nicht nur dort. Kaum die Außenhülle, geschweige denn der Innenraum, ist einladend. Kalt ist es, morbide, manchmal abschreckend. Wir selbst in den Gemeinden, wir lieben unsere Kirchen. Uns stören die Falten nicht an denen, die wir lieben. Diese Liebe hat unsere Kirchen erhalten in den Jahren, vor allem in den Jahren der DDR. - ABER
Sie sind unsere Plakate. „Kleider machen Leute“, sagt Gottfried Keller. Das gilt auch für unsere Kirchen.
So wie sie aussehen, werden andere uns sehen. Das kann man schlecht finden, es ist aber so. Sie sind die Zeugnisse des Glaubens aus vergangener Zeit. Aber was sie eigentlich sein wollen, wozu sie einmal gebaut wurden, ist, dass sie Zeugnisse und Orte des Glaubens in der Gegenwart sein sollen. Sind sie das?
Ist unser Glaube so, angestaubt, mit Rissen, miefig und ein gehöriges Stück morbide?
Nein. Das was wir haben, unser Evangelium von Jesus Christus, ist das, was unserer Gesellschaft nötiger als alles andere braucht. Wissen wir das noch? Es ist nicht miefig und angestaubt, weil ER lebendig ist.
Das muss unter die Leute. Anders als früher, mit Sicherheit. Nicht an jedem Ort, weil es nicht zu schaffen ist, nicht nur mit alten Formen, weil sie nicht verstanden werden und oft auch nicht mehr passen. Dafür braucht es Räume und dafür braucht es Freiräume, finanzielle und gedankliche.
Darum haben wir auf diese Synode gedrungen, weil es uns im Bauausschuss, der ja ein Ausschuss unserer Synode ist, genau darum ging. Nicht um Denkmalschutz zuerst, nicht um Traditionen, sondern darum, dass Gemeinde Räume und Freiräume hat, wo es sich gut leben lässt.
Und deshalb ist es nicht die Frage, welche Gebäude haben wir? Sondern, welche Gebäude braucht die Gemeinde? Diese Unterscheidung ist vielleicht auf den ersten Blick nicht sonderlich aufregend, aber sie ist in Wahrheit umstürzend, wenn man sie wirklich stellt.
Das ist es, was wir auf dieser Synode mit Ihnen vorhaben, Sie anzustiften, diese Frage, welche Gebäude braucht die Gemeinde, wirklich in aller Radikalität zu stellen. Nicht nach den Häusern zu gucken, sondern nach dem, was wir brauchen.
Unsere Vision als Bauausschuss, das will ich Ihnen verraten, ist die starke Reduzierung des Gebäudebestandes. Verkaufen, verschenken, abbrechen, außer Dienst nehmen, was nur Nerven, Kraft und Geld verschlingt. Unsere Plakate aber erhalten, die Gemeindearbeit wieder in die Kirchen ziehen. Dort finden uns die Menschen, in den Häusern mit dem Turm in der Mitte unserer Dörfer und in der Mitte unserer Städte.
In größeren Gemeinden kann das bedeuten, alles loswerden, was nicht wirklich gebraucht wird.
Ich mache es konkret an vier fiktiven Beispielen, mit denen ist sie nicht verprellen, sondern im besten Sinn provozieren will als Leitungsorgan unseres Kirchenkreises.
1.
Da ist eine Stadtgemeinde in unserem
Kirchenkreis. Die hat stolze vier Kirchen.
Sie entschließt sich, eine Kirche zu ihrer Gemeindekirche zu machen. In diese
Kirche wird eine Heizung eingebaut, eine Toilette, eine Küche. Die Kirche ist
so, dass man nach dem Gottesdienst dort Kaffee trinken kann. (Naja, das ist bei
vielen Kirchen schon so).
Die anderen Kirchen werden ohne schlechtes Gewissen den Steinen gegenüber nicht
mehr abwechselnd mit der Hauptkirche bespielt, weil nämlich 95% aller Einwohner
keinen Gemeindebrief und 75 % keine Tageszeitung erhalten und wenn sie uns
suchen, wir vielleicht gerade in der anderen Kirche sind.
Die anderen Kirchen werden in ihrer Substanz erhalten, ohne dass jemand ein
schlechtes Gewissen hat. Das Geld ist da konzentriert, wo Gemeinde ist. Wenn
diese Kirche dann eines Tages zu klein ist, wird die nächste saniert und ein
zusätzlicher Gottesdienst angeboten.
2.
Das Gegenbeispiel, eine
Kleinstgemeinde mit 40 Mitgliedern. In der Kirche findet einmal im Monat ein
Gottesdienst statt. Im Winter trifft sich die Gemeinde im Pfarrhaus nebenan.
Der eine Konfirmande alle vier Jahre ist am Hauptort in einer Gruppe, die zwei
Senioren werden schon lange abgeholt ins Nachbardorf.
Die 40 zumeist älteren Menschen erhalten zwei Denkmale für insgesamt 12
Veranstaltungen. Was braucht diese Gemeinde wirklich? Was braucht sie, um zu
wachsen? Wie kommen Menschen aus diesem Ort zum Glauben? Wie und wo wecken wir
ihr Interesse für unsere Botschaft?
Braucht es das Pfarrhaus, braucht es die Kirche? Wäre es vielleicht besser, im
Nachbarort fände regelmäßiger Gottesdienst statt? Der Pfarrer hätte danach noch
eine Minute Zeit und würde nicht gleich weiterfliegen? Dann bräuchte es weder
Pfarrhaus noch Kirche. Das Pfarrhaus würde verkauft werden, die Kirche in ihrer
Außenhülle erhalten.
Radikal? Gewiss – von Radix – die Wurzel. Der Kirchspielrat und die Pfarrerin
hätte zwei Baustellen weniger – nicht nur in baulicher Hinsicht.
3.
Eine Gemeinde mit einigen Gruppen
und Kreisen, die sich im Pfarrhaus treffen. Daneben- ein kleiner Gemeindesaal. Der
Gottesdienstraum ist liebevoll eingerichtet.
Hier ist im Winter Gottesdienst und, weil es viel netter ist als in der Kirche
und wärmer, auch im Frühling und im Herbst.
So fristet die an sich schöne Kirche in einer kleinen, aber lebendigen Gemeinde
ein stiefmütterliches Dasein. Der Gemeinderaum sei doch schön, da könne doch
jeder zum Gottesdienst kommen. Kaum einer ahnt, dass die innere Schwelle in so
einen Raum, in ein Haus, zu gehen, noch viel höher ist, als die in eine Kirche.
Das ist doch Quatsch, Herr Wachter, das kennen die doch alle aus
dem eigenen Konfirmandenunterricht noch.
Nun, zu mir kam vor einigen Wochen ein Mädchen, die seit Jahren zu unserer
Kinder- und Jugendarbeit gehört. Sie ist nicht getauft. Gern wollte sie sich
taufen lassen und mit den anderen in der Gruppe Konfirmation feiern. Aber ihre
Mama hat zu ihr gesagt: Nein, du, sowas
Neumodernes fangen wir nicht an. Ich und auch deine Oma sind schon zur
Jugendweihe gegangen, das ist in unserer Familie lange Tradition.
Das ist unsere Realität, auch wenn sie am Ende ihre Mutter doch überzeugen
konnte und vorletzten Sonntag getauft wurde. Aber zurück zum Haus:
Die Schwierigkeiten an dem Pfarrhaus werden größer. Irgendwann muss gehandelt
werden.
Sanierungsuntersuchung, Kostenschätzung, 300T€. Aber eigentlich braucht keiner
die Wohnung im Obergeschoss. Das ganze Verwalten und Hausmeisterspielen… Wer
macht das? Wollten wir nicht ein Gemeindefest organisieren?
Was braucht diese Gemeinde?
Vielleicht eine Winterkirche, einen schönen und ansprechenden Raum unter der
Orgelempore, eine Toilette und die Kirche heizbar.
Alle Gruppen würden sich in der Kirche treffen, der Ort der Glaubensgeschichte
wäre wirklich allen vor Augen. Mit dem Einbau der Winterkirche ist dann
ein Drittel der lang ersehnten Innensanierung bereits geschafft, und 300T€ sind
bei weitem nicht ausgegeben worden.
Das alte Pfarrhaus wird verkauft. Die Gemeinde konzentriert Engagement, Geld
und Elan auf das eine Gebäude, auf ihr Plakat. Wenn es irgendwo reinregnet,
wenn irgendwo Putz abfällt, eine Scheibe kaputt ist, wird es gleich gesehen und
repariert.
Die Leute aus der Kleingemeinde in der Nachbarschaft fühlen sich wohl, wenn sie
dorthin abgeholt werden.
4.
Eine Gemeinde, die ihren Schwerpunkt
wirklich im Gottesdienst hat. Sie kann ihre Kirche unmöglich aufgeben. Sie ist
wertvoll, als Denkmal.
Touristen kommen. Hier lohnen sich sogar Konzerte. Zum Dorffest sind Himmel und
Menschen da. Aber das riesengroße Pfarrhaus braucht sie eigentlich ebenso wenig
wie den Stress mit den Mietern, die ihre kleine Miete ohnehin nicht regelmäßig
zahlen.
Die kleine Seniorengruppe trifft sich schon längst im Dorfgemeinschaftshaus.
Braucht sie eine Winterkirche?
Wäre nicht eine Toilette und eine Bankheizung völlig ausreichend? Was dann an
Geld und Elan noch da ist, fließt in die Sanierung im Inneren, damit das
Gebäude als unser Plakat auch etwas Schönes ausstrahlt?
Liebe Synodale, wir brauchen eine offene Debatte, unbedingt. Wir können und dürfen das nicht verschlafen. Vielleicht liegt in der Krise eine Chance, Gemeinde neu zu denken, endlich zu akzeptieren, dass wir eine Minderheit sind, dass wir es nicht aufhalten, nicht den Verfall des Alten - und dass wir nicht mit den alten Mitteln Neues schaffen können.
Aber, und das erzähle ich Ihnen zum Schluss… Wissen Sie was der
Kairos ist? Das ist ein griechisches Wort für die Zeit. In der Mythologie ist
es der Gott des rechten Ausgenblicks. Er huscht vorbei und man muss ihn packen,
ihn festhalten, damit er einem nicht entwischt, der rechte Augenblick, und es
dann zu spät ist. Nun, der Kairos ist schnell, das wissen wir alle, der rechte
Zeitpunkt ist schnell verpasst. Aber warum kann man ihn nicht greifen?
Sehen sie, dem geht es wie mir, der hat eine Glatze. Allerdings ist seine
Frisur umgekehrt. Er hat die Locke vorn. Man muss ihn, den Kairos, beim Schopfe
packen. Daher unsere Redewendung. Man muss ihn schnappen, wenn er da ist, sonst
bleibt es dabei, man hechelt hinterher und hält ihn nicht auf.
Ich wünsche Ihnen in den Regionen jetzt gute und konstruktive
Gespräche bei einem ersten Prozess der Gebäudeplanung. Ich danke ausdrücklich
den Mitgliedern des Bauausschusses, die sich neben Arbeit und Firma, Familie
und Ausschussarbeit noch zusätzlich in die Materie vertieft haben und Sie jetzt
moderierend begleiten werden.
Diskutieren sie offen, streiten sie in christlichem Geist, seien sie kontrovers
aber auch konstruktiv und stellen Sie sich für Ihre Region die Frage, die uns
die Superintendentin aufgegeben hat: Welche Räume braucht die Gemeinde?


































Fotos: Kirchenkreis Halberstadt